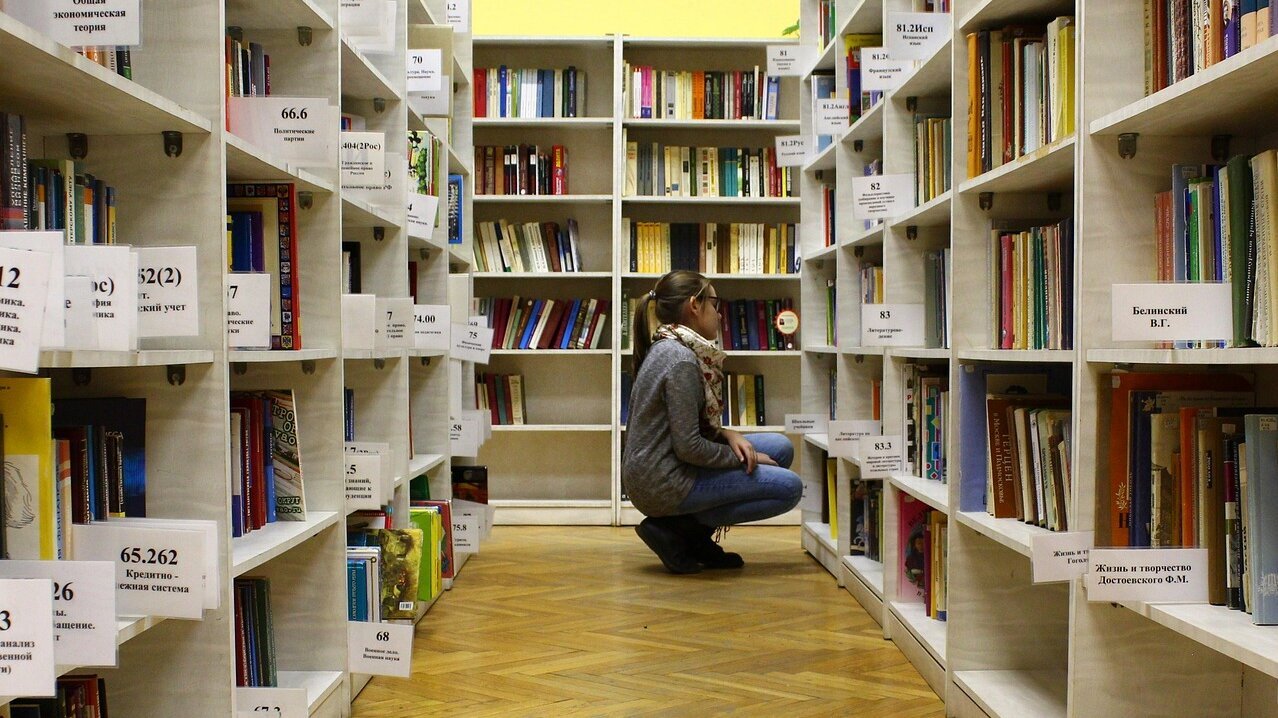Mit dem Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 09. Juli 2025 hat der Landesgesetzgeber in Nordrhein-Westfalen das kommunale Vergaberecht unterhalb der EU- Schwellenwerte grundlegend reformiert. Ab dem 01. Januar 2026 erhalten die bisherigen Vergabegrundsätze nach § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) in § 75a Gemeindeordnung NRW einen völlig neuen Rechtsrahmen. Künftig ist es nicht mehr die Landesregierung, sondern es sind die Kommunen, die über die Regeln für kommunale Vergaben im Unterschwellenbereich entscheiden. Die Kommunen erhalten nach dem Willen des Gesetzgebers den Spielraum, sich in einem durch allgemeine Grundsätze beschriebenen Rechtsrahmen die Regeln zu geben, die sie für zweckmäßig halten.
Will ein kommunaler öffentlicher Auftraggeber eine Bau-, Liefer- oder Dienstleistung entgeltlich beschaffen, muss bisher ein vergaberechtliches Verfahren durchgeführt, sofern der zu schätzende Auftragswert eine bestimmte Wertgrenze überschreitet. Die Rechtsquellen finden sich auf mehreren Ebenen. An der Spitze stehen die Vergaberichtlinien der EU, deren Umsetzung in nationales Recht u. a. in dem 4. Teil des GWB, der VgV und der SektVO erfolgt ist. Überschreitet der nach § 3 VgV bzw. § 2 SektVO zu schätzende Auftragswert die EU-Schwellenwerte von aktuell 5.538.000 Euro (netto) für Bauleistungen und 221.000 Euro (netto) für Liefer- und Dienstleistungen (443.000 Euro (netto) für Sektorentätigkeiten), so muss auch der kommunale Auftraggeber den Auftrag EU-weit ausschreiben und ein förmliches Vergabeverfahren durchführen.
Unterhalb dieser Schwellenwerte bestimmen die Länder durch Landesvergabegesetze oder wie in NRW bisher über im Haushaltsrecht (§ 26 KomHVO) verortete Bestimmungen, welche Regeln für die kommunalen Vergaben gelten. In Nordrhein-Westfalen war dieser Rahmen im Wesentlichen durch den auf der Grundlage des § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ergangenen Runderlasses des heutigen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) geprägt. Dieser bindet die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen im Unterschwellenbereich für Liefer- und Dienstleistungen an die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) und bei Bauaufträgen an den 1. Abschnitt der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A).
Kern der Reform ist die künftig eigenständige Entscheidung über die Ausgestaltung der Vergabeverfahren durch die Gemeinden selbst. Die Landesregierung erlässt demnach keine verbindlichen Vergabegrundsätze mehr. Durch allgemeine Prinzipien aus § 75a GO NRW wird der rechtliche Rahmen dennoch grob vorgegeben. Demnach haben Gemeinden öffentliche Aufträge wirtschaftlich, effizient und sparsam unter Beachtung der Grundsätze von Gleichbehandlung und Transparenz zu vergeben, wobei die Geltung höherrangiger Vorschriften unberührt bleibt. Diese Grundsätze sollen auch ohne die bisherigen Vergabevorgaben einen fairen und geordneten Wettbewerb gewährleisten.
Darüber hinaus müssen Gemeinden weitere, bereits bekannte Grundsätze beachten, nämlich die Grundsätze der sich aus dem EU-Recht ergebenden Binnenmarktrelevanz sowie der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung gemäß § 7 Landeshaushaltsordnung sowie §§ 75, 110 GO NRW, welche nicht nur im Oberschwellenbereich gelten.
Zu den Zielen und Vorteilen der Reform gelten Effizienz und Flexibilität für die Gemeinden. Durch den Wegfall der starren Vergabegrundsätze soll der Abbau von Bürokratie und Beschleunigung von Vergabeverfahren erzielt werden. Fristen, Überprüfungen und Prozesse können demnach von Gemeinden selbst bestimmt und an den jeweiligen Beschaffungsbedarf angepasst werden, was eine Erhöhung der kommunalen Flexibilität mit sich bringt. Damit einhergehend erlaubt es eine effizientere Einsetzung von Personalressourcen, was dem Fachkräftemangel in Vergabestellen entgegenwirkt.
In Zukunft müssen Gemeinden ihre Vergabeverfahren per Satzung regeln. Die Satzung ist ortsüblich bekanntzumachen und online zugänglich, was mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und sich bewerbenden Auftragsnehmern schafft. Am 26. August 2025 wurde eine Mustersatzung veröffentlicht, an der der Städtetag NRW, der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW mitgewirkt haben. Die Mustersatzung orientiert sich an den bisherigen Verfahren, gewährt aber mehr Freiräume. Kommunen sollen Wertgrenzen für Direktaufträge und jeweilige Vergabearten selbst festlegen. Oberhalb der Wertgrenzen für Direktaufträge könne das Vergabeverfahren frei gewählt werden, darunter die öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb. Ein Rotationsprinzip bei der Wahl von Auftragsnehmern soll der Vermeidung von „Hoflieferantentum“ dienen und ein Stückelungsverbot soll die künstliche Aufteilung von Aufträgen zur Umgehung von Schwellenwerten verbieten. Vorgeschlagen wurde ebenfalls eine Dokumentationspflicht in Textform für drei Jahre. Bei der Erteilung von Zuschlägen soll das unter Berücksichtigung von Preis, Qualität, Zweckmäßigkeit etc., wirtschaftlichste Angebot ausgewählt werden. Die Mustersatzung bietet einen ersten Überblick über mögliche Regelungsinhalte., jedoch orientiert sie sich sehr stark an den bisherigen gesetzlichen Regelungen, so dass für eine unbürokratische Regelung und Handhabung noch viel Spielraum besteht.
Der Gesetzgeber in NRW hat den Gemeinden einen erheblichen Spielraum bei der Ausgestaltung von Vergabeverfahren eingeräumt und ihnen damit viel Verantwortung übertragen. Bei korrekter Umsetzung, insbesondere der Wahrung der europarechtlichen Grundsätze und Beachtung der örtlichen Gegebenheiten, werden die vergaberechtlichen Spielräume der Kommunalverwaltungen größer.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Prof. Dr. Sven-Joachim Otto und Dr. Jochen Heide gerne zur Verfügung.